Lendico ist eine international agierende „Peer-to-Peer“-Lending-Plattform für Privatpersonen und mittlerweile auch für Unternehmen. Die in Berlin ansässige Online-Plattform wurde im Dezember 2013 von der börsennotierten Gesellschaft Rocket Internet gegründet. Inspiriert wurde das Geschäftsmodell von der US-amerikanischen P2P-Plattform Lending Club und der britischen Plattform Zopa. Innerhalb der ersten 20 Monate wuchs das Unternehmen, welches anfangs in Deutschland agierte, auch international und ist derzeit in Österreich, Brasilien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Südafrika tätig.[1]
Der Kreditmarktplatz wirbt damit, dass Kreditnehmer und Anleger auf diese Art einfacher zusammenfinden und die Kreditvermittlung kostengünstiger ist als bei herkömmlichen Banken. Es können sich beispielsweise private Kreditnehmer bei Lendico registrieren und einen Privatkredit bis zu 30.000 Euro beantragen. Das Kreditprojekt erscheint auf der Lendico-Plattform, sobald die Rahmenbedingungen des Kredites vom Kreditnehmer bestätigt wurden. Bei Prüfung des Bonitätsprofils berechnet Lendico eine einmalige Gebühr in Höhe von 0,25 % bis 4,5 % des Gesamtkreditbetrages. Die Lendico-Gebühr wird direkt vom Gesamtkreditbetrag abgezogen. Anleger können nach Veröffentlichung des Projektes auf der Plattform 14 Tage lang entscheiden, ob sie das Kreditprojekt unterstützen möchten. Sobald ein Anleger ein Gebot abgegeben hat, wird via E-Mail ein Unterbeteiligungsvertrag zugesandt. Falls das Kreditprojekt nicht zu 100 % finanziert wurde, kommt kein Geschäft zustande.
Aus Anlegersicht lockt die Kreditvermittlungsplattform damit, dass man sein Geld „smart“ anlegen kann. Darunter versteht man unter anderem den Vorteil, dass man sich bereits ab 25 Euro (bis zu 10.000 Euro) ein eigenes Portfolio zusammenstellen kann. Lendico bringt Anleger mit Kreditnehmern zusammen und erspart so die hohen Kosten traditioneller Banken, welche dann in Form von attraktiven Renditen an die Anleger weitergegeben werden können. In Bezug auf die Sicherheit beschreibt die Kreditplattform, dass Finanzexperten und Banker mit langjähriger Erfahrung in der Kredit- und Risikoanalyse Lendico aufgebaut und strikte Qualitätsstandards bei der Überprüfung der Kreditanträge etabliert haben. Die Anleger erhalten die Zins- und Tilgungszahlungen ihrer Kreditprojekte monatlich auf ihr Bankkonto überwiesen, wobei Lendico von der monatlichen Gesamtsumme aller Zahlungen aufgrund der Anlagen eine Servicegebühr von 1,0 % verrechnet und die restlichen 99,0 % den Anlegern bleiben. Bei verspäteten Raten bzw. bei Zahlungsausfall eines Kreditnehmers übernimmt die Kreditvermittlungsplattform das Forderungsmanagement. Nach mehreren Mahnungen wird ein Inkassounternehmen beauftragt.
Während das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen im ersten Halbjahr 2014 noch 252 Kredite vergab, waren es im zweiten Halbjahr bereits 874 Kreditprojekte.[2] Welche Auswirkungen der P2P-Kredit für Kreditnehmer, Anleger und die Kreditplattform selbst hat, wird anhand eines Beispiels illustriert: Eine Person benötigt für die Ausbildung einen Privatkredit in Höhe von 1.000 Euro. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre. Aufgrund des angenommenen höheren Bonitätsrisikos beträgt die einmalige Gebühr 3,0 % und der jährliche Zinssatz wurde mit 8 % ermittelt. Das heißt, der Kreditnehmer würde in diesem Fall die Kreditsumme in Höhe von 970 Euro erhalten, die restlichen 30 Euro behält Lendico als Gebühr. Die jährliche Annuität beträgt 560,77 Euro. Unter dieser jährlichen Annuitätenannahme beträgt die monatliche Rückzahlung bei einer zweijährigen Laufzeit 46,73 Euro. Um als Kreditnehmer 970 Euro zu erhalten, bezahlt man in den kommenden 24 Monaten also in Summe 1.121,53 Euro. Das ergibt für die gesamte Laufzeit einen Aufschlag von 15,6 %.[3]
Aus Anlegerperspektive wird nun angenommen, es habe sich jemand am zuvor erwähnten Anlageprojekt mit 100 Euro beteiligt. Der monatliche Rückzahlungsbetrag in Höhe von 4,67 Euro[4] wird nun nach Abzug der Lendico-Servicegebühr (1 % der Zins- und Tilgungszahlung) überwiesen, sodass der Anleger monatlich 4,62 Euro[5] erhält. Falls nun alles gut läuft und der Kreditnehmer nicht zahlungsunfähig wird, sollte der Anleger nach 24 Monaten in Summe 110,95 Euro erhalten.[6] Das ergibt für die gesamte Laufzeit (zwei Jahre) einen Aufschlag – vor Steuern – in Höhe von knapp 11,0 %.
Unter der weiteren Annahme, dass 10 Anleger mit jeweils 100 Euro diesen Kredit finanziert haben, kann vermutet werden, dass Lendico bei der Kreditvermittlung in Höhe von 1.000 Euro im Idealfall[7] mit 41,22 Euro[8] partizipiert. So würde die Kreditplattform – gemessen an diesen Annahmen – bei einem Kreditvolumen von 100 Millionen Euro[9] Umsatzerlöse von etwa 4,1 Millionen Euro erwirtschaften. Dies kann somit durchaus ein lukratives Geschäft für die Kreditplattformbetreiber werden und dürfte sich auch auf traditionelle Kreditgeschäfte von Banken auswirken.
[1] Vgl. Lendico (2016a), URL: https://www.lendico.com/.
[2] Vgl. Rocket Internet (2015), S. 83.
[3] Nebenrechnung: [{(1121,53/970)-1}*100 = 15,6].
[4] Entspricht in diesem Fall einem Zehntel der monatlichen Gesamtrückzahlung, da der Anleger sich mit einem Zehntel am Kreditprojekt beteiligt hat.
[5] Nebenrechnung: [(46,73-0,47) = 46,26].
[6] Nebenrechnung: [(46,26*24) = 1.110,24].
[7] Der Idealfall meint hier, dass vom Kreditnehmer alle Zahlungen getätigt wurden.
[8] Der Betrag errechnet sich aus der Summe der einmaligen Lendico-Gebühr für die Kreditnehmer in Höhe von 3 % [1.000*3 % = 30] und der kumulierten Lendico-Service-Gebühr für Anleger in Höhe von 1 % [0,04673*24*10 = 11,22].
[9] Vgl. Rocket Internet (2015), S. 83.
Der Text ist ein Auszug aus dem Buch „Sharing Economy“ von Simon Schumich – hier versandkostenfrei zu bestellen


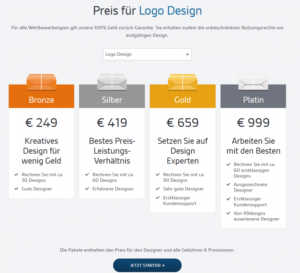
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.